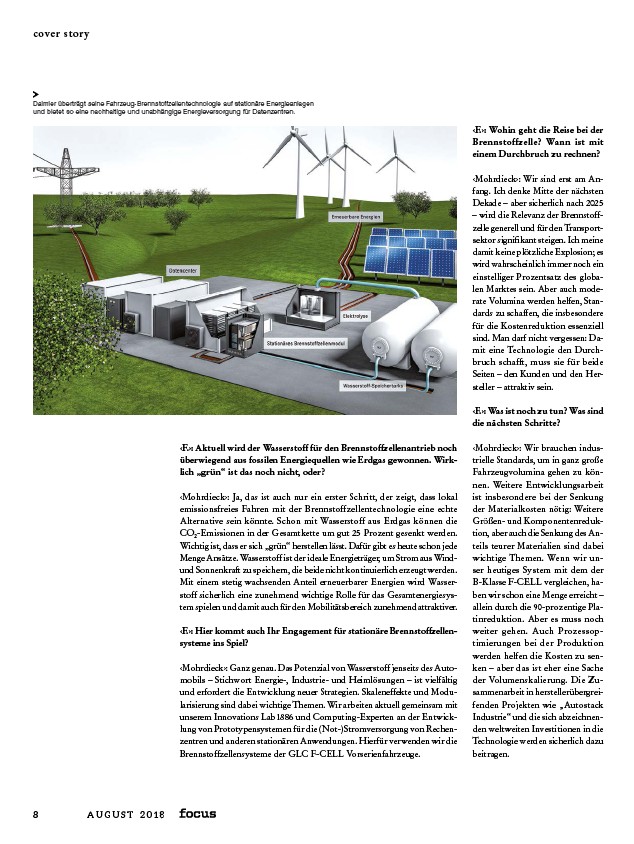
cover story
8 A U G U S T 2 0 1 8
‹F.›: Aktuell wird der Wasserstoff für den Brennstoffzellenantrieb noch
überwiegend aus fossilen Energiequellen wie Erdgas gewonnen. Wirklich
„grün“ ist das noch nicht, oder?
‹Mohrdieck›: Ja, das ist auch nur ein erster Schritt, der zeigt, dass lokal
emissionsfreies Fahren mit der Brennstoffzellentechnologie eine echte
Alternative sein könnte. Schon mit Wasserstoff aus Erdgas können die
CO2-Emissionen in der Gesamtkette um gut 25 Prozent gesenkt werden.
Wichtig ist, dass er sich „grün“ herstellen lässt. Dafür gibt es heute schon jede
Menge Ansätze. Wasserstoff ist der ideale Energieträger, um Strom aus Wind-
und Sonnenkraft zu speichern, die beide nicht kontinuierlich erzeugt werden.
Mit einem stetig wachsenden Anteil erneuerbarer Energien wird Wasserstoff
sicherlich eine zunehmend wichtige Rolle für das Gesamtenergiesystem
spielen und damit auch für den Mobilitätsbereich
zunehmend attraktiver.
‹F.›: Hier kommt auch Ihr Engagement für stationäre Brennstoffzellensysteme
ins Spiel?
‹Mohrdieck›: Ganz genau. Das Potenzial von Wasserstoff jenseits des Automobils
– Stichwort Energie-, Industrie- und Heimlösungen – ist vielfältig
und erfordert die Entwicklung neuer Strategien. Skaleneffekte und Modularisierung
sind dabei wichtige Themen. Wir arbeiten aktuell gemeinsam mit
unserem Innovations Lab1886 und Computing-Experten an der Entwicklung
von Prototypensystemen für die (Not-)Stromversorgung von Rechenzentren
und anderen stationären Anwendungen. Hierfür verwenden wir die
Brennstoffzellensysteme der GLC F-CELL Vorserienfahrzeuge.
‹F.›: Wohin geht die Reise bei der
Brennstoffzelle? Wann ist mit
einem Durchbruch zu rechnen?
‹Mohrdieck›: Wir sind erst am Anfang.
Ich denke Mitte der nächsten
Dekade – aber sicherlich nach 2025
– wird die Relevanz der Brennstoffzelle
generell und für den Transportsektor
signifikant steigen. Ich meine
damit keine plötzliche Explosion; es
wird wahrscheinlich immer noch ein
einstelliger Prozentsatz des globalen
Marktes sein. Aber auch moderate
Volumina werden helfen, Standards
zu schaffen, die insbesondere
für die Kostenreduktion essenziell
sind. Man darf nicht vergessen: Damit
eine Technologie den Durchbruch
schafft, muss sie für beide
Seiten – den Kunden und den Hersteller
– attraktiv sein.
‹F.›: Was ist noch zu tun? Was sind
die nächsten Schritte?
‹Mohrdieck›: Wir brauchen industrielle
Standards, um in ganz große
Fahrzeugvolumina gehen zu können.
Weitere Entwicklungsarbeit
ist insbesondere bei der Senkung
der Materialkosten nötig: Weitere
Größen- und Komponentenreduktion,
aber auch die Senkung des Anteils
teurer Materialien sind dabei
wichtige Themen. Wenn wir unser
heutiges System mit dem der
B-Klasse F-CELL vergleichen, haben
wir schon eine Menge erreicht –
allein durch die 90-prozentige Platinreduktion.
Aber es muss noch
weiter gehen. Auch Prozessoptimierungen
bei der Produktion
werden helfen die Kosten zu senken
– aber das ist eher eine Sache
der Volumenskalierung. Die Zusammenarbeit
in herstellerübergreifenden
Projekten wie „Autostack
Industrie“ und die sich abzeichnenden
weltweiten Investitionen in die
Technologie werden sicherlich dazu
beitragen.
Daimler überträgt seine Fahrzeug-Brennstoffzellentechnologie
auf stationäre Energieanlagen
und bietet so eine nachhaltige und unabhängige Energieversorgung für Datenzentren.